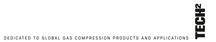Automatisch von KI übersetzt, Original lesen
Gasmotorenleistung: Turbogeladenes Potenzial trifft auf Turboloch-Realität
16 Mai 2025
Neuer Bericht unterstreicht starke Nachfrage, warnt aber vor Gegenwind bis 2040.

Die weltweite Nachfrage nach Gaskraftwerken boomt: Laut einer neuen Analyse von Wood Mackenzie werden die Bestellungen von Gasturbinen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 32 % steigen. Das Beratungsunternehmen spricht von einer regelrechten Goldgräberphase, angetrieben durch den rasant wachsenden Strombedarf und den globalen Ausstieg aus der Kohle. Trotz dieser positiven Nachfrageprognose steht der Sektor jedoch vor erheblichen strukturellen Herausforderungen, die das Wachstum in den nächsten 15 Jahren bremsen könnten.
In ihrem Bericht „Turbocharged vs. turbo lag: the new landscape for gas-fired power“ (Turboaufladung vs. Turboloch: Die neue Landschaft der Gaskraftwerke) stellt Wood Mackenzie fest, dass sich die Gasindustrie an einem Wendepunkt befindet. Zwar bietet Gas die notwendige Flexibilität, um die schwankende Produktion erneuerbarer Energien auszugleichen, doch könnten Engpässe in der Lieferkette, steigende Kapitalkosten und sich verändernde politische Rahmenbedingungen eine längere Phase des „Turbolochs“ verursachen.
Wachstum angetrieben durch den globalen Energiebedarf
Erdgas bleibt in vielen Regionen ein wichtiger Übergangsbrennstoff. In den USA wird ein Rekordwachstum der Gaskraftwerkskapazität bis 2040 erwartet, unter anderem aufgrund seiner Rolle bei der Unterstützung des Strombedarfs von Rechenzentren im Zuge des Ausbaus künstlicher Intelligenz (KI). Deutschland plant, bis 2030 20 GW an neuer Gaskapazität zu installieren, um aus Kohle und Kernenergie auszusteigen. Auch Südostasien, der Nahe Osten und Afrika rechnen mit einem starken Wachstum der Gaskraftwerkskapazität, um den steigenden Strombedarf zu decken.
China ist führend beim Gasausbau im asiatisch-pazifischen Raum , obwohl sein Anteil an der Stromerzeugung im Vergleich zu Kohle weiterhin gering ist. Japan und Südkorea setzen auf Gas, um veraltete Kraftwerke zu ersetzen, während Lateinamerika Gas zur Unterstützung erneuerbarer Energien und zur Bewältigung von Lastspitzen einsetzt.
Turboloch: Fertigungs- und Kostenbeschränkungen
Trotz dieses breiten Interesses zeichnen sich in der Praxis Engpässe ab. Die weltweiten Produktionskapazitäten für Turbinen werden voraussichtlich bis 2025 nahezu vollständig ausgelastet sein, und die langen Vorlaufzeiten verschieben die Inbetriebnahme neuer US-amerikanischer GuD-Kraftwerke bereits in das nächste Jahrzehnt.
Steigende Kapitalkosten verschärfen die Lage. In den USA haben die Kosten für neue GuD-Kraftwerke historische Höchststände erreicht, was durch gegenseitige Zölle noch verstärkt wird. Wood Mackenzie prognostiziert, dass die Kapitalkosten bis 2028 auf 2.800 US-Dollar/kW steigen könnten. Dies bringt Projektentwickler in eine Zwickmühle, da die Großhandelspreise für Strom in vielen Märkten weiterhin unter den Kosten neuer Gaskraftwerke liegen.
Im asiatisch-pazifischen Raum haben hohe LNG-Importpreise die Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas geschwächt. Die politischen Entscheidungsträger bleiben nach den Preisspitzen im Jahr 2022 infolge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine vorsichtig. Die meisten Märkte der Region betrachten Erdgas mittlerweile primär als Spitzenlastquelle, während erneuerbare Energien und Kohle weiterhin die Hauptrolle bei der Grundlastversorgung spielen.
Europa schlägt einen anderen Weg ein. Dort drängen CO₂-Bepreisung und ambitionierte Dekarbonisierungsstrategien Erdgas ohne CO₂-Abscheidung an den Rand. Wachsende Energiespeicher- und Lastmanagementkapazitäten stellen die Rolle von Erdgas als Ausgleichsenergieträger zusätzlich infrage.
Die Aussichten nach 2030 hängen von Infrastruktur und Innovation ab.
Mit Blick auf die Jahre 2030–2040 dürfte die Zukunft der Gaskraftwerke von mehreren ungeklärten Faktoren abhängen. Einer davon ist das Tempo und der Umfang des Wachstums von Rechenzentren , insbesondere in Nordamerika. Zwar war die Nachfrage im Zusammenhang mit KI ein wichtiger Faktor für den Neubau von Rechenzentren, doch die jüngsten Projektstornierungen großer Technologieunternehmen werfen Fragen hinsichtlich ihrer langfristigen Tragfähigkeit auf.
Die Investitionsbereitschaft der Branche in zusätzliche Produktionskapazitäten bleibt ebenfalls ungewiss. Nach mehreren Konjunkturzyklen mit anschließendem Auf und Ab zögern Turbinenhersteller, ohne klare, langfristige Nachfragesignale zu expandieren.
Neue Technologien wie die CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCUS) sowie die Beimischung von Wasserstoff bieten unter den aktuellen Klimabedingungen potenziell lebensrettende Alternativen für die Gasverstromung. Wood Mackenzie weist jedoch darauf hin, dass die Stromgestehungskosten (LCOE) von mit CCUS ausgestattetem Gas weiterhin deutlich höher sind als die von Gas ohne CO₂-Abscheidung und -Speicherung und dass die kommerzielle Nutzung noch in den Anfängen steckt.
Schließlich stellt die Infrastruktur im mittleren Bereich einen entscheidenden Engpass dar. In den USA verzögern Genehmigungsverfahren und Widerstand aus der Bevölkerung weiterhin Pipeline- und Kompressionsprojekte . In ganz Asien sind erhebliche Investitionen in Regasifizierungsterminals , Pipelines und Gasspeicher erforderlich, um das zukünftige Wachstum des Energiesektors zu unterstützen.
MAGAZINE
NEWSLETTER